Künstliche Intelligenz (KI, oder auch AI = “Artificial Intelligence”) in Hörgeräten ist seit Jahren ein Thema. Je mehr es gehyped wird, desto unübersichtlicher wird es für uns Kunden, herauszufinden, was die KI unserem Hören denn wirklich bringt. Mit meinem Hintergrund als Informatikerin habe ich auf der EUHA 2025, dem europäischen Hörakustikerkongress, mit allen großen Hörgeräteherstellern gesprochen. Ich hoffe dir hier mit meiner Einschätzung etwas Orientierungshilfe zu geben.
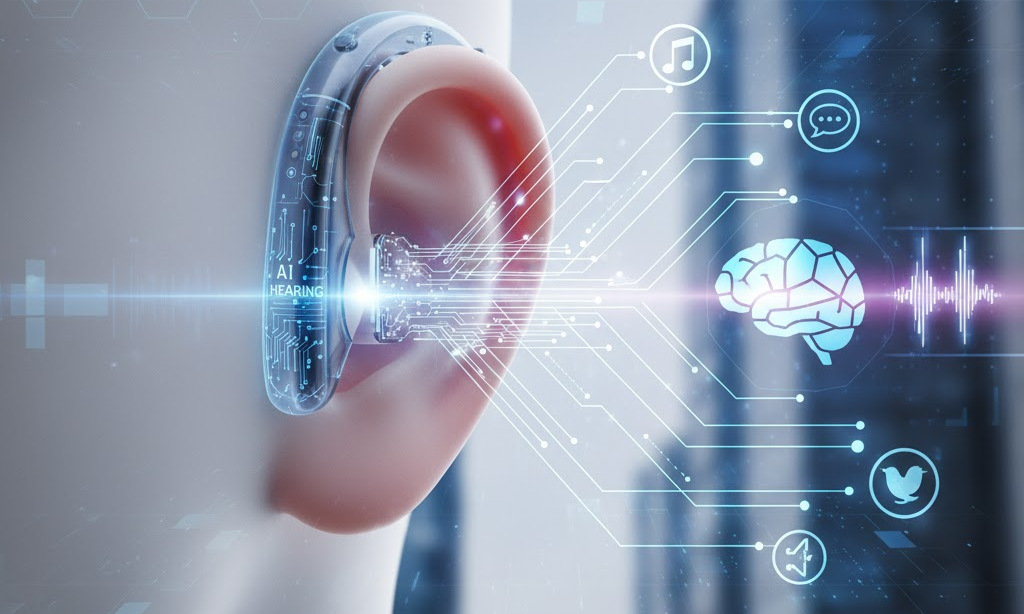
Ich habe mich dabei auf folgende Fragen konzentriert:
Für welche Aufgaben im Hörgerät wird KI benutzt?
Auch wenn es vielen so vorkommt, als wäre KI etwas neues, so gibt es die Grundprinzipien schon seit dem letzten Jahrhundert. Unter dem Oberbegriff des maschinellen Lernens bezeichnet man KI-Systeme, die von großen Datenmengen lernen und sich die Regeln oder die Essenz dieser Daten selbst erschließen. (Ganz genau betrachtet gibt es Feinheiten zwischen den Begriffen “Maschinelles Lernen” und “Künstliche Intelligenz”, aber sie werden im aktuellen Diskurs selten klar voneinander getrennt und daher belassen wir es auch hier dabei.)
Es gibt zwei relevante Arten von Systemen: die, die etwas generieren, wie z.B. ChatGPT oder Gemini, welches man bitten kann ein Gedicht zu schreiben oder einen Artikel zusammen zu fassen. Interessanter für Hörgeräte ist allerdings eine zweite Art von Systemen, nämlich solche, die etwas klassifizieren:
- Eine Geräuschsituation einzuordnen: bin ich gerade auf einer lauten Familienfeier mit vielen Sprechern und viel Störgeräusch oder sitze ich in der Oper und lausche der Musik? Je nach erkannter Situation, kann das Hörgerät dann ein anderes Programm auswählen, was für diese Situation optimiert ist.
- Hintergrund- und Vordergrundgeräusche identifizieren, relevante Sprecher identifizieren. Wenn diese Kategorisierung funktioniert, kann das Hörgerät dann die Hintergrundgeräusche gut herausfiltern, bzw. dämpfen und die relevanten Sprecher hervorheben.
- Parameteroptimierung. Selbst in einer bestimmten Situation und mit einem bestimmten Programm, gibt es noch einen Haufen Parameter eines Hörprogrammes, deren Einstellungen die KI optimal einstellen lernen kann.
Wie lange gibt es KI schon in Hörgeräten?
Tatsächlich ist es sehr viel länger als es der aktuelle Hype erscheinen mag. Viele Hersteller verbessern ihre Signalverarbeitung seit Jahrzehnten mit maschinellem Lernen. Was sich in den letzten Jahren verändert hat, ist, dass die Prozessoren dafür noch besser, kleiner und billiger geworden sind. Damit haben manche Algorithmen, insbesondere DNNs (Deep Neural Networks = tiefe neuronale Netze), nun genug Ressourcen, um große Datenmengen zu verarbeiten und damit bessere Ergebnisse zu erzielen. Was sich auch geändert hat, ist das Auftauchen von generativer KI, die aber bei Hörgeräten eher zweitrangig sind, aber sehr präsent in den Medien sind.
Wann und wie lernen die Geräte?
Ein definierendes Merkmal von KI ist, dass es Systeme sind, die etwas aus einer Datenbasis heraus lernen. Wann und wie tun sie das bei Hörgeräten? Bei den meisten Herstellern ist es so, dass sie in ihrem Haus mit sehr vielen Sounddaten die KI-Systeme trainieren und als Ergebnis ein sogenanntes Modell erstellen. Dieses Modell ist dann eine kleine Entscheidungsmaschine. Diese wird in die Hörgeräte (zusammen mit der Software, die da sowieso drauf kommt) gespielt und dann tut sie dort ihren Job, genauso wie andere Signalverarbeitungsalgorithmen.
Das heißt insbesondere, dass diese Systeme nicht mehr weiterlernen, nachdem du sie am Ohr hast. Das wiederum heißt – wie attraktiv das auch wäre – dass sie sich nicht noch individueller auf dein Leben anpassen. Die einzige Weise, auf die das Modell in Zukunft verbessert wird, ist durch Software/Modell-Updates, welche du bei deine:r Akustiker:in oder per Hörgeräte-App vom Hersteller bekommen kannst. Dabei hätte eine Individualisierung durchaus seinen Reiz. Stell dir vor, dein Hörgerät lernt mit der Zeit die wichtigsten Menschen in deinem Leben besonders gut zu verstehen oder die Akustik der Orte, an denen du am meisten bist, besonders gut zu unterstützen. Da sind wir noch nicht ganz, auch wenn das vielleicht irgendwann mal möglich ist. Ein paar Ansätze, die in diese Richtung gehen, gibt es bereits, wie ihr unten lesen könnt.
Was bedeutet der Einsatz von KI für den Stromverbrauch der Hörgeräte?
Für manche Algorithmen in der KI, insbesondere DNNs, braucht man spezielle Prozessorchips (es geht auch ohne, aber dann ist es noch langsamer und stromfressender). Diese Chips werden bei manchen Hörgeräten zusätzlich zum bereits vorhandenen Prozessor eingebaut. Das führt zu zwei Problemen: Zum einen verbrauchen dann beide Prozessoren zusammen mehr Strom. Das führt dazu, dass Akkus oder Batterien weniger lange halten. Außerdem ist es in manchen Fällen so, dass sie zu Spitzenzeiten mehr Spannung brauchen, als manche Hörgerätebatterien hergeben. Aus diesem Grund bieten manche Hersteller KI nur in Geräteserien an, die es nur noch mit Akkus gibt. Das wiederum schränkt unsere Auswahl ein, sollten wir keine Akkus haben wollen. Hörgeräte mit KI müssen übrigens nicht immer und kontinuierlich KI benutzen, sondern vielleicht nur in besonders schwierigen Situationen wie Verstehen im Störlärm. Das heisst insbesondere, dass je nach dem wieviele Stunden am Tag du in einer solchen Situation bist, du mehr oder weniger Strom verbrauchst.
Hast du als Benutzer Transparenz und Kontrolle darüber, wann und wie viel KI benutzt wird?
Angesichts dessen, dass manche Arten von KI-Algorithmen in Hörgeräten einen signifikanten Einfluss auf den Stromverbrauch haben, ist es eine berechtigte Frage, wie viel Kontrolle ich als Nutzer darüber habe, wann diese angewendet werden oder nicht. Hier gibt es verschiedene Varianten. Manche Hersteller schalten die KI automatisch an oder aus, aber limitieren sie auf eine bestimmte Anzahl Stunden. Das sichert, dass der Rest der Akkulaufzeit noch für den Rest des Tages reicht. Andere Hersteller finden, dass ihre Geräte meistens ohne diese stromhungrigen Algorithmen auskommen. Für die wenigen Situationen, wo dem nicht so ist, geben sie dir als Nutzer die Möglichkeit, die KI explizit an- bzw. auszuschalten (als separates Programm oder als Einstellung in der Hörgeräte-App). Einige Hersteller bieten solche Algorithmen allerdings auch gar nicht explizit an, sondern verlassen sich auf die bewährten Algorithmen, die immer noch einen guten Job machen und nicht mehr Strom brauchen.
Verbessert der Einsatz von KI das Hörerlebnis wirklich?
Das ist die große Frage – besonders wenn wir mehr Geld fürs Hörgerät und den Stromverbrauch zahlen und eventuell dadurch sogar Kompromisse bei der Auswahl der Geräte machen müssen. Hierzu gibt es noch keine großflächigen Erfahrungen oder Studien. Jeder Hersteller preist natürlich seine Geräte als die tollsten an. Wenn es einen krassen Unterschied machen würde, denke ich, dass wir mehr davon hören würden. Ich würde dir empfehlen, die Auswahl wieviel KI du im Hörgerät haben möchtest, genauso kritisch zu prüfen wie andere Auswahlkriterien. Insbesondere solltest du sie ausgiebig in vielen Situationen testen und besonders ein Auge auf den Stromverbrauch haben. Siehe dazu auch Wie testet man Hörgeräte richtig?. Die neu angepriesenen KI-Algorithmen allein machen nicht per se alles besser, andere Algorithmen haben nach wie vor ihre Daseinsberechtigung.
Was sind die langfristigen Folgen von KI-Algorithmen?
An dieser Stelle ein paar warnende Worte. Sie betreffen nicht nur KI-Algorithmen, sondern alle Features/Filter/Algorithmen in modernen Hörgeräten, die uns das Hören erstmal leichter machen. Das sind alles Dinge, die unser Gehirn auch kann und auch möglichst lange tun sollte. Denn wenn wir unserem Gehirn weniger und weniger zu tun geben, so verkümmert es. Wenn du also die Störlärmunterdrückung oder das Richtungshören völlig den Algorithmen überlässt, dann verlernt dein Gehirn das selbst zu tun. Das kann dazu führen, dass du noch schneller noch schwerhöriger wirst. Siehe dazu auch Warum sind meine Hörgeräte so laut?.
Das ist so ein wenig wie wenn du übergewichtig bist und weil das Laufen nun schwer fällt, überall mit einem Elektrorollstuhl hinfährst. Es leuchtet jedem ein, dass du davon nicht weniger übergewichtig wirst.
Beim Hören ist das Nutzen des Gehirns besonders wichtig, wenn du noch nicht sehr lang oder nicht hochgradig schwerhörig bist. Wenn du deinem Gehirn also noch die ein oder andere Höraufgabe lässt, bleibt es langfristig gesünder. Allerdings hat auch das seine Grenzen. Solltest du eine hochgradige Schwerhörigkeit haben, kommst du wahrscheinlich an einen Punkt, wo du um die besseren Algorithmen nicht herumkommst. Idealerweise möchtest du das aber möglichst lange hinauszögern.
Wo die Hersteller stehen
Hier nun ein Überblick darüber, was die großen Hersteller auf der EUHA gesagt haben. Bedenkt, dass man auf so einer Industrieausstellung immer nur ein paar Minuten an jedem Stand hat. Ich habe mich bemüht, hier alle gleichwertig zu Wort kommen zu lassen, aber manches ist natürlich sehr verkürzt. In alphabetischer Reihenfolge:
- AudioService gab an, dass sie schon sehr lange maschinelles Lernen verwenden. Sie benutzen sie für Situationserkennung, aber auch um die eigene Stimme zu erlernen und damit zu erkennen, an welchem Gespräch du gerade teilnimmst (wenn es mehrere gleichzeitig sind). Sie gaben auch an, dass KI Nutzung zu mehr Stromverbrauch führt.
- Oticon verwendet KI, um Störlärm zu erkennen. Stromverbrauch ist ein Problem, weshalb sie die längste Akkulaufzeit mit nur 30 Stunden angegeben haben.
- Phonak setzt den Fokus sehr auf KI und insbesondere DNNs. Sie verwenden sie zur Situationserkennung (AutoSense) und zum Erkennen von Sprache im Störgeräusch. Stromverbrauch ist ein Problem, weshalb sich diese Algorithmen nur in schwierigen Situationen einschalten und ein Limit von 9-11 Stunden haben. Wenn diese Zeit aufgebraucht ist, gibt es nur noch die “normalen” Programme, bis man den Akku wieder aufgeladen hat. Die maximale Akkulaufzeit wird mit 56 Stunden angegeben (eine Zahl die man mit Vorsicht genießen sollte, siehe auch Warum wiederaufladbare Hörgeräte (noch?) nicht das Wahre sind). Auch hat Phonak erkannt, dass DNN Chips mehr Spannung brauchen als manche Batterien schaffen und bietet daher ihre KI Geräte nur noch in der Akkuvariante an.
- Resound hat zwar KI Algorithmen, aber findet, dass sie nur in schwierigen Situationen (die ca. 5% der Zeit ausmachen) nötig sind und überlassen es dir als Nutzer, sie in der App explizit anzuschalten, wenn du möchtest.
- Signia belässt es vorerst bei den etablierten Algorithmen (die KI enthalten mögen, aber nicht explizit DNNs erwähnen). Das Problem der Spannungsspitzen adressieren sie (leider) auch damit, nur noch Akkugeräte in den neuen Produktreihen auf den Markt bringen. Insgesamt hebt Signia KI aber nicht so sehr in den Fokus wie andere Hersteller.
- Starkey ist sehr prominent unterwegs in Sachen KI und insbesondere DNNs. Sie benutzen es auch vor allem zur Situationserkennung. Das Interessante ist, dass sie für die DNNs keinen extra Chip einbauen, sondern einen einzigen komplett neuen Chip entwickelt haben, der beides vereint, die DNN-Nutzung und die klassischen Signalverarbeitungsalgorithmen. Dieser Chip hat den Vorteil, dass er sogar weniger Strom verbraucht als die Vorgänger (selbst mit DNN-Nutzung). Auch die Spannungsspitzen sind hier nicht das Problem, weshalb Starkey auch weiterhin Batterie-Geräte anbietet. Neben KI in der Signalverarbeitung hat Starkey auch generative KI in ihren Produkten verteilt. So kannst du der App in Worten sagen, wie du deine Hörgeräteeinstellungen anpassen willst (anstatt selbst an den paar Reglern zu ziehen). Das gleiche gibt es für Akustiker in deren Anpassungssoftware. Außerdem hat die App wohl eine Transkriptionsfunktion, also dass das Gehörte in Text umgewandelt wird, welche ein weiterer Einsatz von KI ist.
- Widex setzt explizit auf DNNs und fährt damit weiter ihre Strategie, viele “Soundobjekte” in deiner Umgebung zu erkennen und zu differenzieren und nicht nur stumpf den Sprecher vor dir. Das geht mit DNNs angeblich sehr gut. Strom ist auch hier ein Problem, so dass Widex auch nur noch Akkugeräte mit KI auf den Markt bringt. Widex unterscheidet sich von anderen KI-Hörsystemen dadurch, dass sie auch nach Auslieferung noch lernen können, wenn du das möchtest. Zum einen gibt dir die App die Möglichkeit, zwei verschiedene Einstellungen zu testen (über zwei Buttons mit denen du hin und herwechseln kannst). Diese Eingabe von dir wird gespeichert und fließt in die Intelligenz der Algorithmen ein. Der andere Punkt ist eine Art Schwarmintelligenz, wo die Daten vieler Nutzer im laufenden Betrieb (mit deren Einverständnis natürlich) gesammelt werden um damit die KI weiter zu trainieren. Auch bei Widex hat das Nutzen von DNNs dazu beigetragen, dass die entsprechenden Geräte nur noch mit Akku angeboten werden.
Fazit
Ohne es bisher selbst getestet zu haben, ist es schwer einzuschätzen, wieviel KI in Hörgeräten wirklich bringt. Ich denke in der Signalverarbeitung hat sie ihre Existenzberechtigung und kann sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn du dir bald neue Hörgeräte aussuchen solltest, würde ich dir empfehlen, die KI-Eigenschaften neugierig auszuprobieren, aber nicht überzubewerten. Die althergebrachten Signalprozessorchips haben nach wie vor ihre Qualitäten. Du solltest die KI wie andere Eigenschaften deiner potentiellen Hörgeräte gut testen und in das Gesamtbild für deine Entscheidung einfließen lassen. Entscheide dich nur für KI, wenn es dir so viel bringt, dass du bereit bist, die Kompromisse an anderer Stelle (Aufpreis, Stromverbrauch, nur noch Akku) zu machen. Frage dich auch, ob du stattdessen vielleicht doch lieber deinem Gehirn mehr zutrauen möchtest und weniger den Algorithmen.
Hinweis: für diesen werbefreien Artikel bin ich auf eigene Kosten zur EUHA gereist. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich sehr.

Sehr umfassende und aufschlussreiche Informationen.
Das beste was ich zu der Anwendung von KI in Hörgeräten bisher erfahren habe! Großartig!
Danke
Ein wirklich hervorragender und ausgewogener Beitrag – vielen Dank für diese tiefgehende Analyse!
Gerade der Abschnitt „Was bedeutet der Einsatz von KI für den Stromverbrauch der Hörgeräte?“ ist aus meiner Sicht zentral.
Viele Nutzer unterschätzen, welche praktischen Folgen der zusätzliche Energiebedarf moderner KI-Prozessoren haben kann – von kürzeren Akkulaufzeiten bis hin zu Spannungsspitzen, die bestimmte Batterietypen schlicht überfordern.
Das ist kein Detail, sondern entscheidend für die Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit eines Hörsystems.
Besonders wichtig finde ich aber auch den Teil „Was sind die langfristigen Folgen von KI-Algorithmen?“.
Hier sprichst du einen Punkt an, der im öffentlichen Diskurs viel zu selten vorkommt:
Wenn wir das Hören immer stärker an Algorithmen „outsourcen“, dann besteht die Gefahr, dass das Gehirn selbst verlernt, auditiv zu trainieren und zu differenzieren.
Das ist ein echtes neurokognitives Risiko – und genau deshalb ist gezieltes Hörtraining (z. B. mit kognitiven Methoden) so wichtig, um das Gehirn weiterhin aktiv einzubinden.
KI kann großartige Unterstützung leisten – aber sie darf das natürliche Lernen und die Eigenleistung des Gehirns nicht ersetzen.
Nur das Zusammenspiel aus moderner Technik und aktivem Hörtraining sorgt langfristig für gutes, stabiles Verstehen.
Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag zur Aufklärung in unserer Branche!
Hallo, es ist immer wieder eine Wohltat, einen Sachverhalt so nüchtern und verständlich aufbereitet zu bekommen. Vielen herzlichen Dank, wieder einmal. Und wenn ich darf, ich muss – als hochgradig Hörbehinderter – unbedingt unterstreichen, was Helga geschrieben hat. Bitte bedenkt, dass das Hören nicht im Ohr, sondern im Kopf stattfindet, wo alle Hörimpulse aus dem Innenohr verarbeitet werden. Es geht immer darum, das Gehörte optimal im Hirn zu verarbeiten. Und zwar täglich trainiert, das ist die Einzige Chance, die wir haben. Zudem bin ich auch ein absoluter Anhänger eines selbstbestimmten Hörgeräte-Nutzers und -Nutzens.
Hallo, Du warnst zu Recht vor der Werbung: „Die maximale Akkulaufzeit wird mit 56 Stunden angegeben (eine Zahl die man mit Vorsicht genießen sollte, siehe auch Warum wiederaufladbare Hörgeräte (noch?) nicht das Wahre sind). Auch hat Phonak erkannt, dass DNN Chips mehr Spannung brauchen als manche Batterien schaffen und bietet daher ihre KI Geräte nur noch in der Akkuvariante an.“
Ich trage seit einigen Monaten die neuesten Akku-Geräte von Phonak und ReSound im Vergleich zu meinen „Alt-Geräten“ GNR LiNX Quattro 962-DRW MP von 2019 mit Batterien und habe ich festegstellt: Sowohl das Phonak- als auch das ReSound-Akku-Modell mit KI-Funktion halten im Alltag mit ihren sehr unterschiedlichen Nutzungsprofilen inzwischen deutlich mehr als 30 Stunden durch, selbst bei mehr als 5 Stunden intensivem Umgebungslärm.
Ich bin seit 30 Jahren unfallbedingt hörgeschädigt und seit 2006 Hörgeräteträger.
Herzlichen Dank!
Eine klare und hilfreiche Darstellung der momentanen Möglichkeiten und Begrenzungen der Nutzung von KI in Hörgeräten.
Eine Wohltat im ganzen Werbelärm um KI.